Fusionsreaktoren und Kernfusion als zukunftssichere Stromversorgung? Die Energiewende stellt uns vor neue Herausforderungen. Seit der industriellen Revolution gab es keine so weitreichenden Umstellungen in der Energiegewinnung. Dabei stehen wir vor dem Problem, den Energiehunger unserer modernen Gesellschaft, welcher in den nächsten Jahren nur noch weitersteigen wird, mit den erneuerbaren Energien zu decken.
Für viele geht dabei aber das Gespenst der „Dunkelflaute“ um, welches die Angst vor Stromausfällen oder einem Deutschland weiten Blackout schürt. Dem stellen viele die Entwicklungen der Atomenergie als die beste Energiequelle der Zukunft entgegen. Jedoch nicht die Kernspaltung, was dieses Thema gerne mit der Gesellschaft macht, sondern die Kernfusion. Angesichts der Entwicklungen der letzten Jahre in diesem Thema möchten wir hier einen Überblick schaffen. Wir werden dabei erklären, wie die Kernfusion funktioniert und wie viel Energie frei wird, außerdem werfen wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen.
Worum geht es bei der Kernfusion?

Die Kernfusion wurde wie so viele andere technologische Entwicklung zuerst in der Natur beobachtet und zwar in unserer Sonne. In unserer Sonne werden unter hohem Druck und immensen Temperaturen Element miteinander verschmolzen. Dieser Prozess setzt unglaubliche Menge an Energie frei. Dieses Prinzip versucht man nun auf der Erde zu kopieren, um damit die Energieversorgung für die Zukunft zu sichern. Der große Vorteil dieser Energiequelle ist, dass sie emissionsfrei ist und nur wenige Abfallprodukte produziert.
Doch wie wird das Prinzip der Sonne auf der Erde nachgeahmt? Im Grunde geht es darum, die Wasserstoff Isotope, Deuterium und Tritium miteinander zu verschmelzen. Ein normales Wasserstoffatom besteht aus einem Proton, Deuterium aus einem Neutron und einem Proton und Tritium aus zwei Neutronen und einem Proton.
Durch diese zusätzlichen Teilchen kann man die beiden Elemente in einer Kernfusion miteinander verschmelzen. Dabei ist die Deuterium-Tritium-Fusion (DL) besonders attraktiv, weil sie einen relativ geringen Energieeinsatz bei großer Energieausbeute verspricht. Um zwei Atome zu verschmelzen, muss man die richtigen Bedingungen schaffen. Die Fusion geschieht bei 150 Millionen Grad Celsius, also zehnmal so heiß wie das Innere der Sonne. Daher stammt auch der Spitzname für den chinesischen Reaktor „künstliche Sonne“ (eigentlich HL-2M genannt) sein. Diese hohe Temperatur wird durch Plasmaerzeugung erreicht. Der beste Ort für so eine Reaktion heißt Tokamak.
Ein Tokamak ist im Grunde eine ringförmige Vakuumkammer, die an einen Donut erinnert, mit elektronischen Spulen darum herum. In den 1960er-Jahren entdeckten sowjetische Wissenschaftler, dass derart geformte Gefäße ideal für Fusionsexperimente waren.
Das von ihnen geschaffene Akronym “Tokamak” ist zu einer international anerkannten Form von Fusionsreaktoren geworden. Es gibt auch andere Formen wie den großartig klingenden “Sternensimulator”. Der Donut ist entlang seines Rings gedreht. Die Form war schon immer beliebt, weil so die Bedingungen des Tokamaks besser kontrolliert werden können. Für die Kernfusion wird im Tokamak zunächst ein Vakuum erzeugt, um Verunreinigungen in der Kammer zu entfernen. Anschließend wird es mit Wasserstoff gefüllt und erhitzt. Die Erwärmung erfolgt durch starke Magnetfelder, Beschuss beschleunigter Deuteriumatome und hochfrequente elektromagnetische Wellen wie Mikrowellen.
Durch die Kombination dieser Methoden wird das Plasma auf die erwähnten 150 Millionen Grad Celsius erhitzt. Dann wird Tritium hinzugefügt, um die Kernfusion zu starten. Im besten Fall wird so viel Wärme erzeugt, dass sich das Plasma ohne weitere Heizmaßnahmen selbst erhält. Während Deuterium in der Natur reichlich vorhanden ist (33 Gramm Deuterium in einem Kubikmeter Meerwasser) ist Tritium eine sehr flüchtige Substanz, die in der Natur selten vorkommt.
Der Vorteil von Fusionsreaktionen (Kernfusion) besteht jedoch darin, dass zusätzliches Tritium als Nebenprodukt produziert wird. Bei der Kernfusion werden Deuterium und Tritium zu Helium übrig bleibt ein Neutron. Trifft dieses auf Lithium, gibt es eine Reaktion, aus der Helium und Tritium hervorgehen. Weil man auf diese Art Tritium ernten kann, enthalten die Innenwände des Tokamak in einem Fusionsreaktor Lithium. Dadurch kann die Kernfusions-Reaktion sich selbst am Laufen halten.
Die gute alte Dampfmaschine
So viel zu der Theorie und Funktionsweise eines Fusionsreaktors. Schnell wird klar, dass wir uns mit einer solchen Menge an Energie, die bei der Kernfusion freigesetzt wird, keine Sorgen mehr um Stromausfälle machen müssen. Doch im Endeffekt wird die Energie auf dieselbe Art und Weise gewonnen wie schon seit mehr 100 Jahren: Mit der guten alten Dampfmaschine.
Die Wärme verdampft das Wasser, und der Dampf treibt Dampfturbinen und gewöhnliche Generatoren an, kühlt und wird zurück in den thermischen Reaktor gepumpt. Natürlich kann in einem Fusionsreaktor das heiße Plasma nicht direkt mit dem Wasserkreislauf in Kontakt kommen. 150 Millionen Grad Celsius bringen jedes Material zum Schmelzen.
In einem Tokamak wird das Plasma durch ein starkes Magnetfeld in Form gehalten. Diese wird durch auf minus 269 Grad Celsius gekühlte supraleitende Magneten erzeugt. Lassen Sie den Temperaturunterschied einfach mal auf sich wirken. Das Plasma ist hoch aufgeladen und folgt daher den Feldlinien des resultierenden Magnetfeldes. Trotzdem haben die Wände des Tokamaks es schwer, die Hitze in Schach zu halten. Mehrere Schichten aus Beryllium, Kupfer und hochfestem Stahl speichern die Wärme, ohne das dahinter liegende Kühlwassersystem zu beschädigen.
Lohnt sich dieser ganze Aufwand?
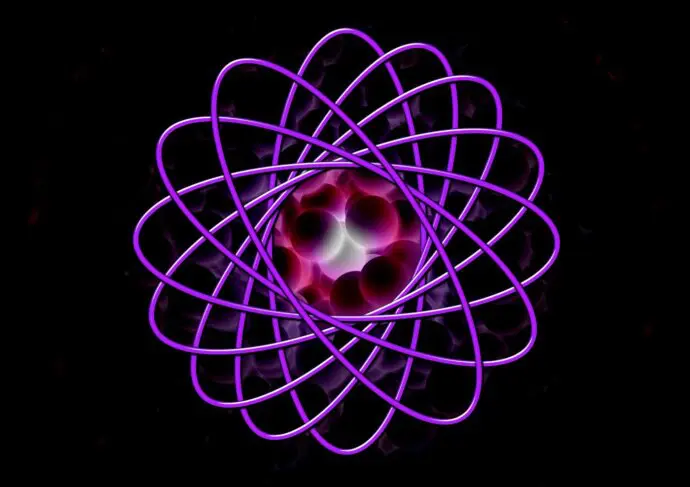
Die Frage ist, wie groß ist die Gefahr vor Stromausfällen und Blackouts in Deutschland aufgrund der Energiewende. Zuletzt kamen die Grünen zu der Überzeugung, dass die Kernfusion ein Milliarden Grab ist und man sich deshalb eher auf nachhaltige Gase oder regenerative Energien fokussieren sollte, auf der anderen Seite träumen die Befürworter der Kernfusion von einer Welt mit unbegrenzter Energie. Hier liegen die Meinungen also, wie auch bei den Risiken der Energiewende, weit auseinander.
Derzeit ist es allerdings so, dass noch immer mehr Energie in Fusionsreaktoren gesteckt werden muss, als letztendlich produziert wird. Der gerade noch im Bau befindliche ITER soll das Zehnfache der Energie produzieren, die der Reaktor verbraucht. Der ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) wird als gemeinsames Forschungsprojekt der Europäischen Union (einschließlich Großbritannien und der Schweiz), der Vereinigten Staaten, Chinas, Südkoreas, Japans, Russlands und Indiens entwickelt, gebaut und betrieben.
Das Forschungszentrum befindet sich seit 2007 im südfranzösischen Cadarache. Anfang 2021 hat die EU weitere 5,61 Milliarden Euro als Forschungsbudget bis 2027 bewilligt. Mit 20 Milliarden Dollar bezieht sich Dudenhöffer offenbar auf die bisher bekannten Gesamtkosten, die sich gegenüber der ursprünglichen Planung verdreifacht haben.
Die kommerzielle Nutzung der Fusionsenergie erfordert aber eine noch höhere Effizienz. Zunächst gilt es jedoch, den Prozess der Kernfusion zu beherrschen und zu optimieren. Der erste Fusionsreaktor, der tatsächlich Strom ins Netz einspeist, soll erst als Nachfolger von ITER gebaut werden. Hinter dem DEMO-System stehen jedoch noch viele Fragezeichen.
Wenn das Ziel jedoch eines Tages erreicht wird, die beteiligten Forscher aller Nationen gehen derzeit von einem Datum um das Jahr 2050 aus, sollte eine erstaunliche Energieproduktion möglich sein.
Friedrich Aumayr, Leiter der Fusionsforschung in Österreich, lieferte dafür denn folgenden Vergleich: „Bei einer Leistung von 3 Gigawatt thermisch, das entspricht einem großen Kohlekraftwerk, bekommen wir ein Gigawatt elektrisch. Um diese Werte zu erreichen, sind etwa 2,7 Millionen Tonnen Kohle notwendig, oder 1,8 Millionen Tonnen Öl, oder 25 Tonnen Uran. Im Fusionskraftwerk brauchen wir dafür nur 350 Kilogramm Deuterium/Tritium.“
Welche Schritte werden für die Energiewende noch unternommen?

Aktuell zeigen sich viele Kunden verärgert über die steigenden, fast schon explodierenden Stromkosten. Es sei aber auch gesagt, dass die aktuelle Preisentwicklung in Teilen mit der hohen Inflation des Euroraums zusammenhängt. Allerdings werden diese Kosten bis zu einem gewissen Punkt Teil der großen strukturellen Herausforderungen bleiben, vor die uns die Energiewende stellt.
Da das konventionelle Stromnetz erhöhtem Druck und Reformzwang ausgesetzt ist, ist es jetzt an der Zeit, sich auf einen weitaus vielfältigeren Energiemarkt vorzubereiten. Der Druck steigt durch zunehmende Energieregulierung, die CO2-Steuer, Anforderungen an die Wartung und Aufrüstung der Netzübertragung, kleinere Nutzerstämme und höhere Kosten für fossile Brennstoffe. Umweltpolitik, steigende Kosten und technologische Innovationen werden unweigerlich viele neue Fragen aufwerfen, die wir uns seit der Einführung des Atomstroms nicht mehr stellen mussten.
Das Stromnetz der Zukunft wird ein anderes sein als das von heute. Statt eines großen Stromnetzes, in dem ein zentrales Kraftwerk über weite Strecken hinweg entfernte Haushalte durch kontinuierliche Bereitstellung erreicht, werden die Stromnetze der Zukunft lokal sein und sehr viel eigenständiger, smarter und autarker agieren.
In den Stromnetzen der Zukunft wird die meiste Energie von stark regionalen Energieversorgern sowie Verbrauchern mit heimischen Solar- oder Windanlagen kommen. Sobald erneuerbare Energien, Mikronetze und dezentrale Energieerzeugung mit Wind- und Solarparks kombiniert werden, sinken auch die Kosten für die Verbraucher. Systemstabilität durch Diversifikation ist die Devise. Das zentrale Kraftwerk hat somit nicht nur als potenzielle Dreckschleuder, sondern auch als Konzept ausgedient. Diese Entwicklung hat natürlich einen Namen: Smart Grids (Smarte Stromnetze).
Um die Energiewende zu schaffen, brauchen wir eine neue Art von Stromnetz. Eines, das von Grund auf darauf ausgelegt ist, die Welle an digitalen und computergestützten Geräten und Technologien zu bewältigen, die von diesem Netz abhängig sind. Außerdem brauchen wird ein Stromnetz, das die zunehmende Komplexität und den Bedarf an Elektrizität im 21. Jahrhundert automatisieren und bewältigen kann.
Wir brauchen also ein intelligentes Netz, das lernen kann. Kurz gesagt, eine digitale Technologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen den Versorgern und Verbrauchern ermöglicht, macht das Netz intelligent. Wie das Internet wird das Smart Grid aus Steuerungen, Computern, Automatisierung und neuen Technologien und Geräten bestehen, die sich ständig austauschen.
Aber in diesem Fall werden diese Technologien mit dem Stromnetz zusammenarbeiten, um digital auf unsere sich schnell ändernde Stromnachfrage zu reagieren und Produktionsspitzen zu speichern bzw. zu nutzen. Diese Änderungen in unserer Energieproduktion können uns damit auf unserem Weg zur grünen Energie der Kernfusion unterstützen.
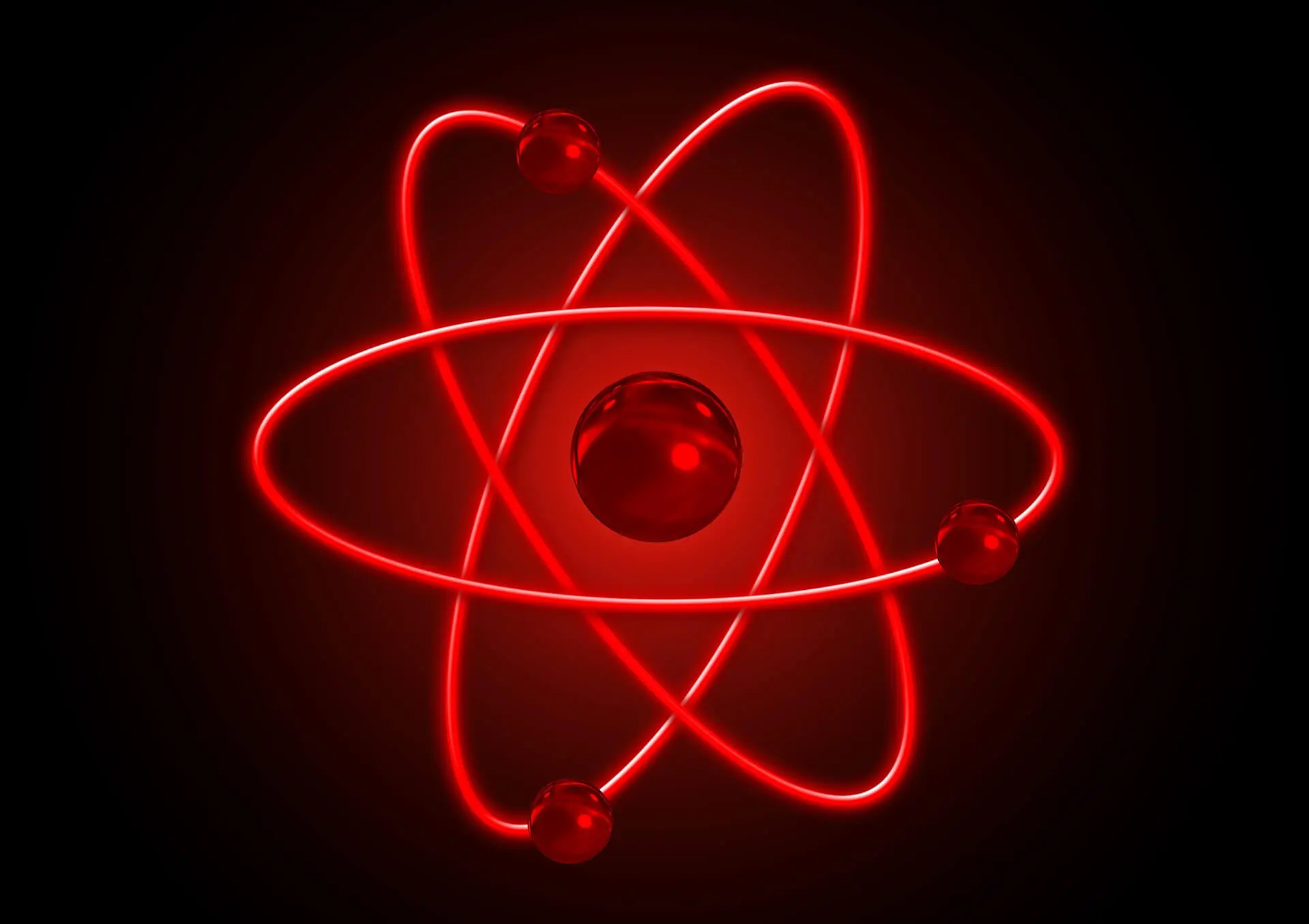
Kommentare